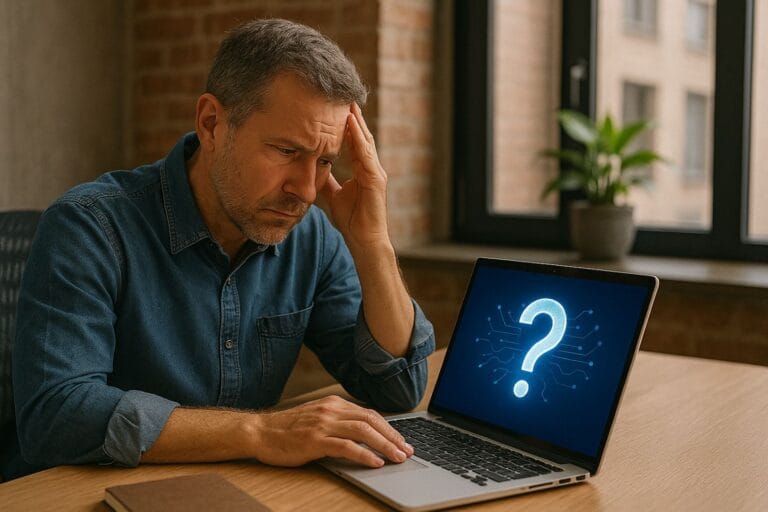Transparenzpflicht nach Artikel 50 KI-Verordnung: Was KMU jetzt wissen müssen
Stellen Sie sich vor, ein Kunde ruft an und fragt: „Haben Sie diese Antwort selbst geschrieben – oder war das KI?“
Genau an diesem Punkt setzt Artikel 50 der KI-Verordnung an. Er legt Unternehmen eine Transparenzpflicht auf, wenn sie KI einsetzen. Für KMU klingt das vielleicht erstmal nach Bürokratie. In Wahrheit geht es aber um etwas anderes: Vertrauen.
Wer hier von Anfang an klar kommuniziert, hat nicht nur die Verordnung auf seiner Seite, sondern auch seine Kunden.
Was bedeutet Artikel 50 der KI-Verordnung für KMU?
Kurz gesagt: Immer wenn Menschen mit Ergebnissen aus KI-Systemen in Kontakt kommen, muss klar erkennbar sein, dass KI im Spiel war.
Das betrifft vor allem Situationen wie:
- ein Chatbot beantwortet Kundenanfragen,
- ein automatisierter Textgenerator erstellt Newsletter oder Website-Texte,
- ein KI-Tool sortiert Bewerbungen vor,
- Bilder oder Videos werden mit KI erstellt.
Im Hintergrund eingesetzte KI-Anwendungen (z. B. Rechtschreibkorrektur oder interne Analyse-Tools) fallen nicht unter diese Pflicht – solange niemand die Ergebnisse für „menschlich“ hält.
Muss jeder KI-Inhalt gekennzeichnet werden?
Inhalte müssen gekennzeichnet werden, wenn Sie von einer KI erstellt werden und der externe Empfänger sonst annehmen könnten, dass ein Mensch den Inhalt erstellt hat.
Beispiele:
- Social-Media-Posts oder Pressemitteilungen aus KI-Tools sollten klar gekennzeichnet sein.
- Interne Notizen oder Vorlagen brauchen keine Kennzeichnung, wenn sie nur der internen Arbeit dienen.
Es gibt aber auch Einschränkungen. Erstellt ein KI-Tool den ersten Entwurf, den dann ein Mensch überarbeitet und dafür auch die redaktionelle Verantwortung übernimmt, dann ist eine Kennzeichnung nicht erforderlich. In diesem Fall wird der Mensch für den Inhalt verantwortlich gemacht. Er macht sich die Zuarbeit der KI zu eigen und muss diese dann auch vertreten.
Die Faustregel: Immer dann kennzeichnen, wenn der Inhalt KI-generiert ist, und wenn es für Empfänger einen Unterschied macht, ob der Inhalt von Mensch oder Maschine stammt.
Über welche KI-Nutzung muss ich informieren?
Die Transparenzpflicht greift, sobald Mitarbeitende oder Kunden mit KI-Ergebnissen in Kontakt kommen.
Chattet also ein Bewerber direkt mit einer KI, dann muss er darüber informiert werden. Chattet er mit einem Menschen, der sich Antwortvorschläge von einer KI erzeugen lässt, ist dies nicht erforderlich. Auch in diesem Fall ist der Mensch verantwortlich für den Inhalt.
Es gibt aber auch Grauzonen. Das Bild zu diesem Artikel ist mit KI generiert. Macht es für den Empfänger einen Unterschied? Wir denken nicht. Deshalb halten wir eine Kennzeichnung direkt am Bild nicht für erforderlich. Unten auf der Seite weisen wir aber darauf hin, dass das Bild per KI generiert wurde.
Wann und wie muss Transparenz erfolgen?
Die Regel lautet: sofort und klar.
- Im Chatfenster selbst, nicht irgendwo in den AGB.
- Direkt unter dem Bild oder Text, nicht erst nach einem Klick.
- In einfacher Sprache, nicht im Juristendeutsch.
Und so kann eine einfache Kennzeichnung aussehen:
- „Dieses Gespräch wird von einem Chatbot geführt.“
- „Dieses Bild wurde mithilfe von KI erstellt.“
- „Ihre Bewerbung wurde auch mit KI-basierten Verfahren geprüft.“
Wichtig: Die Hinweise müssen verständlich und sichtbar sein – nicht im Kleingedruckten. Als alltagstaugliche Lösung für KMU können Standardtexte und Symbole eingesetzt werden, die immer gleich aussehen. So ist die Pflicht ohne großen Aufwand erfüllt.
Was passiert, wenn KMU die Transparenzpflicht ignorieren?
Die KI-Verordnung sieht Bußgelder vor, die sich am Umsatz orientieren können. Noch gefährlicher für KMU ist aber der Vertrauensverlust:
- Kunden fühlen sich getäuscht.
- Bewerber springen ab.
- Partner stellen die Zusammenarbeit infrage.
Schon wegen dieser Risiken gilt: Transparenz ist günstiger als Intransparenz.
Wie dokumentiere ich, dass wir Transparenz sicherstellen?
Dokumentation schützt vor Nachfragen von Behörden – und vor interner Unsicherheit.
Pragmatischer Ansatz für KMU:
- Alle KI-Anwendungen erfassen.
- Prüfen: Kommen Kunden oder Mitarbeitende direkt in Kontakt?
- Standardhinweise formulieren (Textbausteine, Icons).
- Verantwortliche Person benennen.
- Dokumentieren, wann und wie Transparenzhinweise eingesetzt werden.
Das muss kein kompliziertes System sein – eine Excel-Tabelle ist ein guter Anfang. Noch besser ist eine revisionssichere Dokumentation.
Was gilt es nun also zu tun?
Artikel 50 KI-Verordnung klingt nach Pflicht – und ist zugleich eine Chance.
Wer offenlegt, wann KI im Einsatz ist, zeigt Verantwortung und baut Vertrauen auf. Gerade kleine und mittlere Unternehmen können so einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern gewinnen, die lieber „heimlich“ KI nutzen.
Denn am Ende gilt: Ehrliche Transparenz verkauft besser als versteckte KI.
(Das Titelbild für diesen Beitrag haben wir mit KI generiert.)